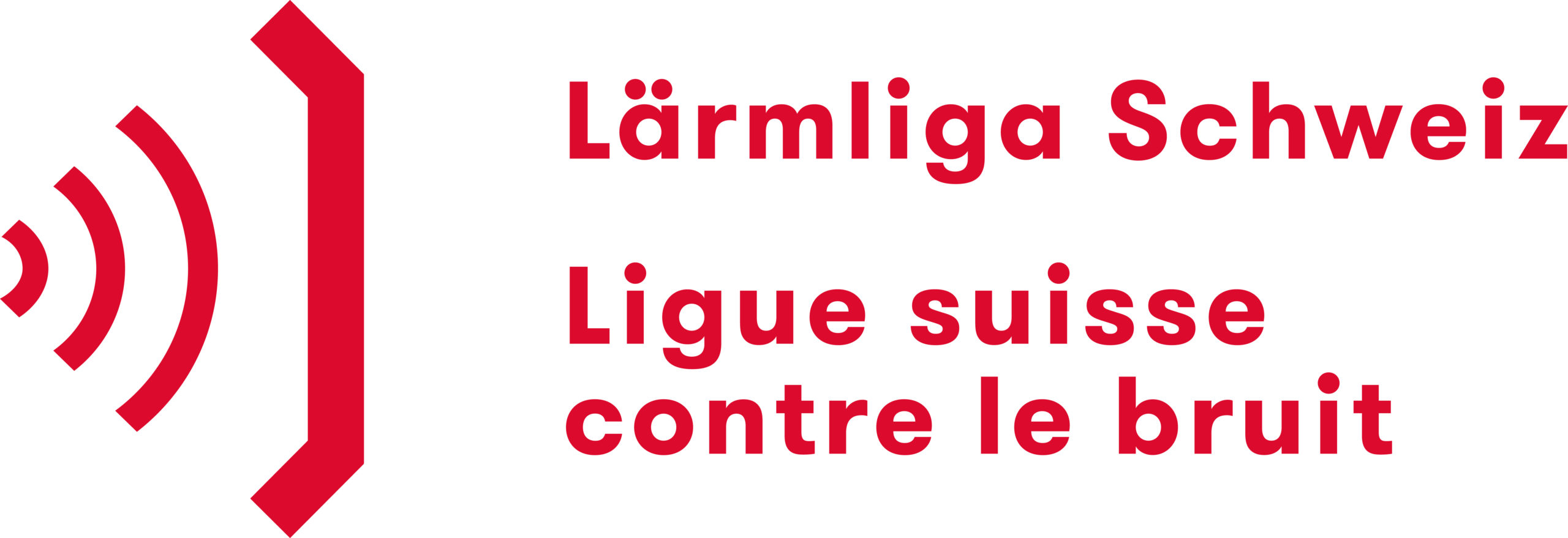Können Pflanzen Stadtlärm wirklich dämpfen?
Ein Beitrag mit Fakten von Kurt Eggenschwiler
Pflanzen verschönern nicht nur das Stadtbild – sie beeinflussen auch den Klang unserer Umgebung. Doch wie wirksam sind sie tatsächlich im Kampf gegen Lärm? Und wo liegen ihre Grenzen? Die Lärmliga Schweiz hat dazu faktenbasierte Einschätzungen von Kurt Eggenschwiler, Experte für Akustik und Lärmminderung, eingeholt.
In der Akustik ist es wichtig, zwischen verschiedenen Wirkprinzipien zu unterscheiden: Schall kann absorbiert, gestreut oder reflektiert werden. Absorption bedeutet, dass Schall von einer Oberfläche aufgenommen, also „geschluckt“ wird. Bei der Streuung wird der Schall in verschiedene Richtungen zerstreut, während er bei der Reflexion zurückgeworfen wird. Der Begriff „Dämpfen“ wird zwar im allgemeinen Sprachgebrauch häufig verwendet, bezeichnet in der Akustik jedoch eine gezielte Schallminderung, durch Schalldämpfer (z.B. Beim Motorenlärm Webinar Motorenlärm).
Strukturreiche Begrünungen wirken sich besonders positiv auf die Schallstreuung aus. Fassaden mit dichter Bepflanzung, insbesondere durch Äste und Blätter, können eintreffenden Schall streuen und dadurch akustischer Monotonie entgegenwirken. Auch der Bodenbelag spielt eine wichtige Rolle: Während humusreiche Wiesen Schall relativ gut absorbieren, reflektieren versiegelte Flächen wie Asphalt, Beton oder Steinplatten nahezu vollständig. Kieswege absorbieren übrigens wenig, erzeugen aber ein charakteristisches, angenehmes Geräusch beim Gehen, das die Klangatmosphäre belebt.
In sehr lärmigen Situationen zeigen sich jedoch auch Grenzen, zum Beispiel im Fall von Reflexionen an einer Wand oder an Fassaden. Eine effektive Reduktion der Lärmbelastung durch vertikales Grün um mehrere Dezibel mit – wie sie für das Einhalten gesetzlicher Grenzwerte notwendig wäre – lässt sich nur mit aufwändigen Systemen erreichen. Herausforderungen sind der notwendige Aufbau für eine gute Wirksamkeit, die Pflanzenart, Wartung und Kosten. Es gibt jedoch vielversprechende Entwicklungen. Auch Insekten und Vögel freuen sich. Einfacher ist eine deutliche Lärmverminderung erreichbar mit Abschirmungen durch begrünte Hügel oder Wälle. Sie unterbrechen den direkten Schallweg, brauchen aber etwas Platz, der im urbanen Raum nicht immer vorhanden ist.
In nicht stark lärmbelasteten Umgebungen geht es mehr um akustische Qualität. Was hier Pflanzen leisten können, wird oft unterschätzt. So können dichte Hecken beispielsweise in Parkanlagen scharfe Rollgeräusche von nahegelegenen Strassen deutlich vermindern. Darüber hinaus fördern Sträucher und Bäume eine angenehme Klanglandschaft, indem sie natürliche Geräusche wie Windrauschen oder Vogelgesang ermöglichen. Und Bäume reflektieren unsere Gespräche und Gehgeräusche angenehm und räumlich, was auch wesentlich zur Aufenthaltsqualität beiträgt.
Im Innenraum ist die Wirkung von Pflanzen auf die Akustik begrenzt, aber dennoch relevant. Einzelne Zimmerpflanzen bieten zwar nur geringe Schallabsorption, streuen jedoch den Schall und verbessern so leicht die Raumakustik. Mehr Wirkung lässt sich mit grossflächigen vertikalen Moos- und Pflanzensystemen oder einer grossen Anzahl an Pflanzen erzielen. Für eine gute Sprachverständlichkeit, wie sie etwa in Klassenzimmern, Restaurants oder Büros erforderlich ist, reicht das jedoch nicht aus. Hier geht es primär darum, den Nachhall zu reduzieren, welche Sprache „verwässert“ und insbesondere für Menschen mit Schwerhörigkeit eine grosse Herausforderung darstellt. Pflanzen allein können diese Anforderungen nicht erfüllen.
Gute Raumakustik ist auch eine Frage der Barrierefreiheit. Das Behindertengleichstellungsgesetz sowie die entsprechenden Normen – etwa SIA 500 „Hindernisfreies Bauen“ und die neue SIA 181/1 „Raumakustik“, die voraussichtlich Ende des Jahres erscheint – stellen klare Anforderungen. Dies bedeutet viel Absorption, die meistens nur durch technische Schallabsorber an Wänden und Decken realisierbar. Pflanzen, sind eine sinnvolle Ergänzung. Sie verbessern nicht nur die Sprachqualität, sondern tragen auch zur vielfältigen Raumwahrnehmung bei. Verschiedene Sinneswahrnehmungen – Sehen, Hören, Riechen, Tasten,… – unterstützen sich gegenseitig und fördern das Wohlbefinden.
Fazit: Pflanzen können einen wertvollen Beitrag zur akustischen Gestaltung von Aussen- und Innenräumen leisten. Im aktuellen Kontext mit Stadtökologie und Biodiversität ist der Zeitpunkt gut, das grosse Potenzial zu nutzen.

Kurt Eggenschwiler, Beirat der Lärmliga Schweiz, leitete von 1999 bis 2019 die Abteilung Akustik/Lärmminderung der Empa und lehrte an der ETH Zürich. Der ausgewiesene Experte für Raum- und Umweltakustik engagiert sich heute im Ruhestand weiterhin für eine bessere Klangqualität im Aussenraum.